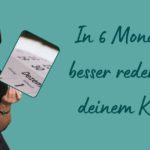Unser tägliches Brot in der Familie, in Kitas oder Schulen: Wie setzen wir Kindern Grenzen ohne zu strafen? Ein Perspektivenwechsel und eine Reflexion sind hierbei nützlich. Lass uns die Sache doch mal genauer betrachten. Was sind die Grenzen? Was ist anders als früher? Wie sagen wir das, was wir sagen wollen? Und: wie kann es besser gelingen?
Was sind eigentlich Grenzen, die wir Kindern setzen?
Da gibt es
- gesellschaftliche Normen, wie „im Restaurant ruhig sitzen bleiben“
- familiäre Regeln, wie z.B. spezielle Zeiten für Essen, Fernsehen, Schlafengehen
- persönliche Grenzen, wie Müdigkeit, Krankheit, Schamgrenze …
Manche dieser Grenzen sind statisch, manche sind variabel und von verschiedenen Umständen abhängig. So wird im Urlaub oder am Wochenende manches anders gehandhabt, manches ist auch tagesformabhängig. Je nachdem führen diese Grenzen dann dazu, dass Erwachsene von Kindern etwas fordern, sie von etwas abhalten wollen und mehr oder weniger freundlich und nachdrücklich auf etwas bestehen.
Für meine Generation war das einerseits genauso, andererseits waren die Grenzen wesentlich mehr erwachsenen-zentriert. Die Interessen oder Meinungen der Kinder zählten nicht: „Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst …“
Die pädagogische Entwicklung
Die Bindungstheorie, die Neurowissenschaft, die Emotionsforschung und die Achtsamkeitsforschung haben dazu beigetragen, dass wir heute ein ganz anderes Bild vom Kind und von der Erziehung haben.
Wir sprechen heute von einer bedürfnis- und beziehungsorientierten Sicht auf das Kind und die Pädagogik.

All diese verschiedenen Bedürfnisse haben Kinder. Und Erwachsene haben sie genauso. Und die Familie hat als solche auch noch Bedürfnisse. Diese alle unter einen Hut zu bringen, ist eine tägliche Herausforderung und eine echte Kunst.
Kinder haben eigene Entwicklungsaufgaben, z.B. das Bedürfnis etwas zu lernen, ihre Selbstwirksamkeit zu erleben, das Bedürfnis nach Autonomie auszuleben usw. Kollidieren diese Bedürfnisse mit den Bedürfnissen und Zielen der Erwachsenen, entstehen Konflikte. Das ist normal.
Wir respektieren heute alle Arten von Gefühlen. Es sollte selbstverständlich sein, dass – egal ob Junge oder Mädchen – Wut, Angst und Trauer genauso in Ordnung sind, wie Freude und Zufriedenheit. Allerdings brauchen die Kinder beim Umgang mit diesen Gefühlen noch die Hilfe der Erwachsenen. Das ist dann Co-Regulation.
Kinder wollen nicht tyrannisieren und sie brauchen keinen „Bedürfnis-Erfüllungs-Automat“. Sie brauchen Erwachsene, die ihnen eine liebevolle Führung, Halt und Orientierung geben. Sie wollen und brauchen Erwachsene, die ihre eigenen Bedürfnisse kennen und dafür sorgen, dass die eigenen Batterien halbwegs aufgeladen sind. Dann nämlich sind diese Erwachsenen auch in der Lage, eigene Grenzen zu kennen und mit Haltung und klarer, wertschätzender Kommunikation diese zu vertreten.
Wie wir Grenzen üblicherweise setzen
- „Du sollst nicht auf dem Sofa hüpfen!“
- „Nein, du bekommst jetzt kein Eis vor dem Abendessen!“
- „Wir werfen nicht mit Sand!“
- „Oh ne, ich will jetzt nicht noch eine Geschichte vorlesen!“
Das sind typische Beispiele. Meist geht es darum, was die Kinder nicht dürfen oder was sie nicht tun sollen. Dabei sind gerade die Negationen (Verneinungen) so schwer verständlich.
Du kennst sicher den Satz: „Denk jetzt nicht an einen rosa Elefanten!“ – Bestimmt hast auch du den rosa Elefanten vor Augen. Das liegt an unseren unterschiedlich funktionierenden Gehirnhälften. Vereinfacht gesagt, analysiert die linke Gehirnhälfte den Satz, inklusive der Verneinung. Allerdings erzeugt die rechte Gehirnhälfte das Bild des rosa Elefanten. Und dann entsteht Verwirrung im Kopf, das „nicht“ geht verloren und so bleibt eben nur das Bild vom rosa Elefanten übrig.
Genauso ist es mit den oben genannten Sätzen. Hinzu kommt dann noch ein Verwirrung stiftender Tonfall oder ein „wir“ am falschen Platz.
Wie wir Grenzen sinnvoll formulieren
Vor allen Dingen fehlt in meinen Beispielen oben etwas: nämlich das, was das Kind stattdessen tun soll oder darf.
- „Du darfst auf der Matratze im Kinderzimmer hüpfen.“ (alternativ: „Komm, wir malen ein Hüpfekästchen-Spiel auf die Terrasse.“)
- „Das Abendessen ist gleich fertig. Du darfst inzwischen den Tisch decken.“
- „Stopp! Schau mal, der Sand ist Tim ins Gesicht geflogen. Das tut weh. Magst du Sand im Gesicht? … Komm, wir helfen Tim beim Saubermachen. … Wollt ihr jetzt zusammen einen Berg bauen?“
- „Heute bin ich müde. Es bleibt bei einer Geschichte. Lass uns morgen ein wenig früher ins Bad gehen, dann kann ich länger lesen.“
Das ist eine Auswahl an möglichen Reaktionen. Sie sind natürlich immer von der Situation, vom Alter des Kindes und von der eigenen Verfassung abhängig.
Hier geht es also darum, Kinder klar zu führen. Indem du ihnen sagst, was der mögliche oder der erlaubte Rahmen ist, gibst du ihnen eine Orientierung. So machst du es dir und dem Kind leicht.
Sei außerdem wirklich präsent bei der Sache. Stelle einen Kontakt her. Mit den 3A kannst du in 3 Schritten mehr Aufmerksamkeit erreichen.
Und achte darauf, dass du bei Aufforderungen auch einen Aufforderungssatz formulierst. Wir tappen häufig in die Höflichkeitsfalle und sagen Sätze, die missverständlich und unklar sind. Mehr dazu liest du in Heilpädagogische Sprachförderung – mit klaren Ansagen mehr erreichen.
Wertschätzung statt Strafen
Du bist immer Vorbild.
Sprache steckt an, ob mit dem Dialekt, dem Wortschatz oder dem Umgang. Wie oft sagst du „Ich komme gleich …“? Und dein Kind weiß genau: Dieses „gleich“ ist ein ziemlich dehnbarer Begriff. Ganz klar, den benutzt es dann auch. Zum Beispiel auf dem Spielplatz, beim Abholen aus der Kita, wenn du zum Essen rufst …
Welche anderen deiner Verhaltensweisen spiegelt dein Kind? Starrt dein Teenie genauso während eines Gesprächs ins Smartphone wie du? Welche Schimpfwörter benutzt du beim Autofahren? Respektierst du, wenn dein Kind etwas nicht essen mag? Wie viel Erwachsene essen aus ethischen oder gesundheitlichen Gründen etwas nicht, oder einfach, weil sie es nicht mögen?
Natürlich gilt es bei manchen Themen deinen Schutzauftrag und deine Verantwortung als Erwachsene zu wahren. Und ich erinnere nochmal daran, dass es nicht um Wünsche, sondern um Bedürfnisse geht. Deine Bedürfnisse sind ebenso berechtigt.
So geht es also um Gleichwürdigkeit. Es geht auch darum, Zumutungen gerecht zu verteilen. Das sind Lernaufgaben. Für dich – mach dir bewusst, worum es gerade geht. Und für das Kind – es wird mit deiner Begleitung lernen, damit umzugehen.
PS: Logische Konsequenzen – nichts anderes als Strafen, beschreibt Danielle Graf in ihrem Artikel sehr ausführlich.